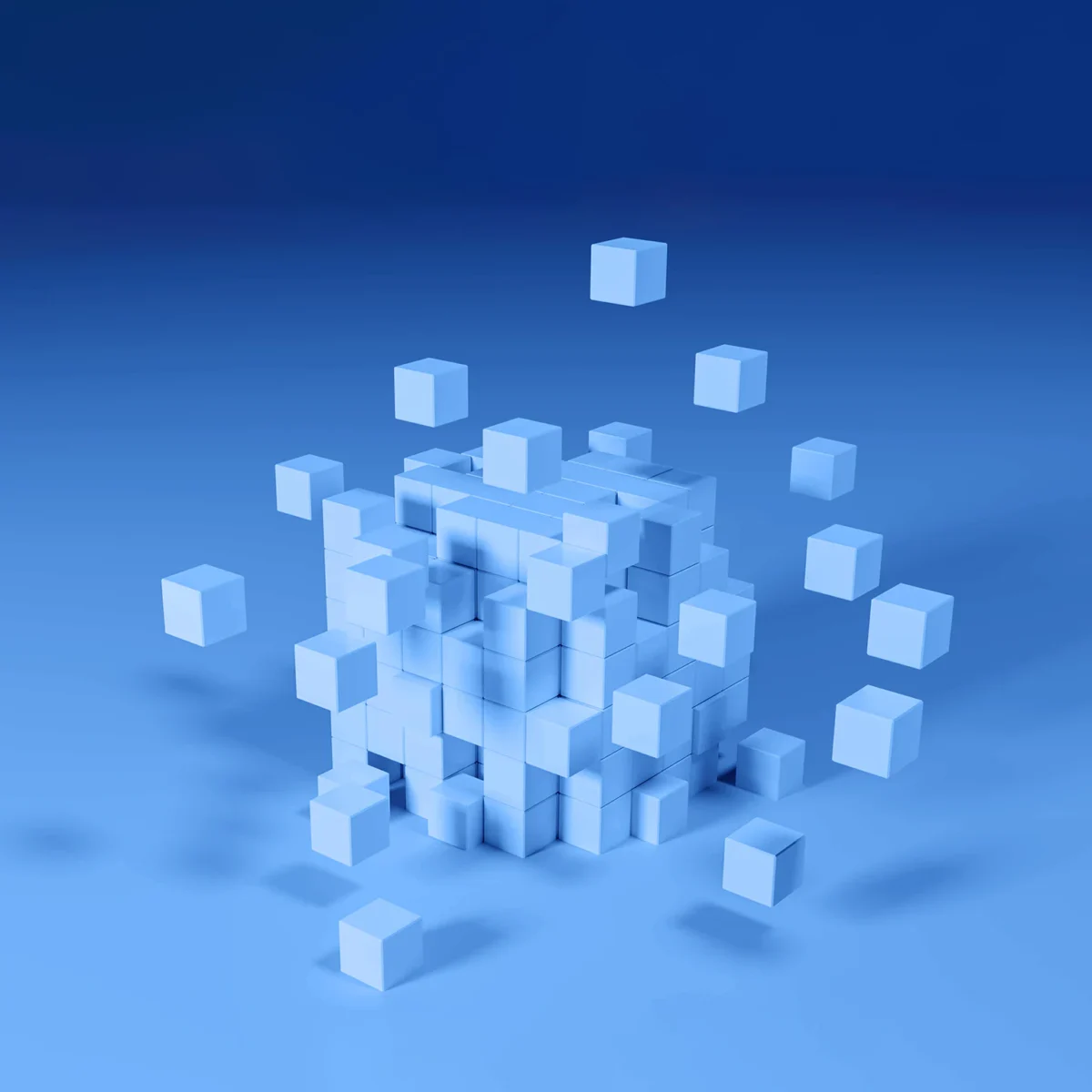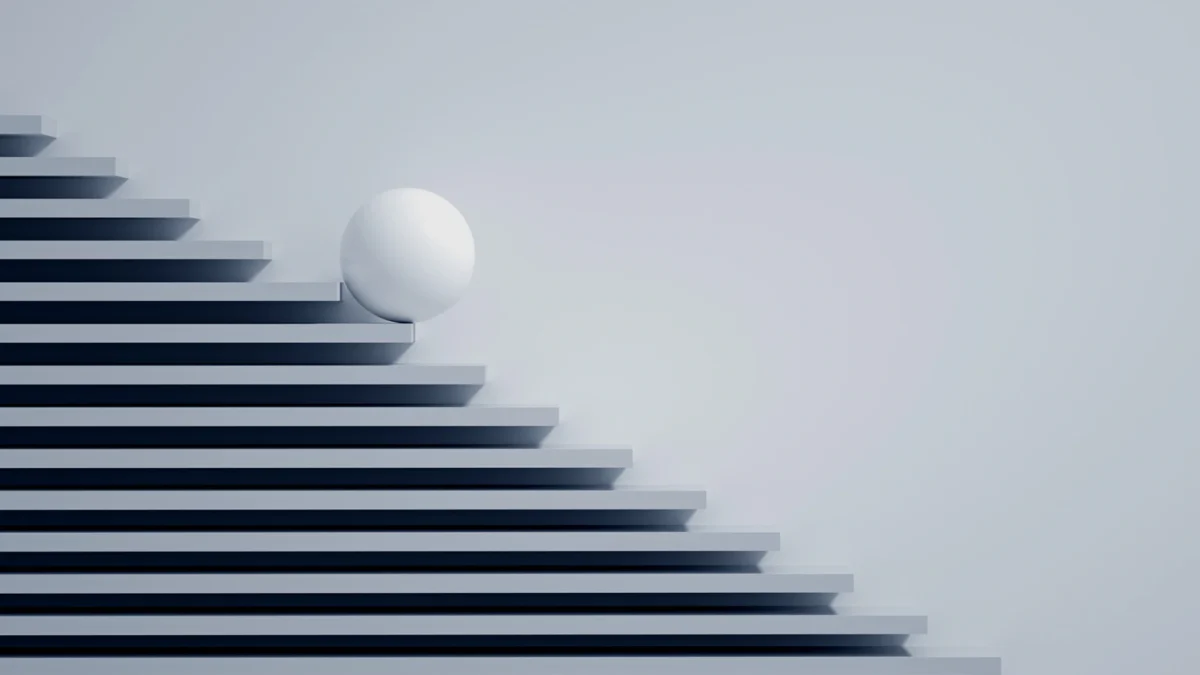Im Kontext der zunehmenden Verbreitung von KI müssen IT-Teams ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Kontrolle finden. Strukturierte Workflows bleiben unerlässlich, um Vollständigkeit und Datenqualität sicherzustellen, während Agents eine Agilität versprechen, die über reinen Code hinausgeht.
Dieser Artikel stützt sich auf die Erfahrungen von Liip und zeigt auf, wie Sie sich zwischen LangGraph, einem Code-First-Framework für Task-Graphen, und LangFlow, einem Low-Code-Werkzeug für schnelle Prototypen, entscheiden. An konkreten Beispielen erfahren Sie, wie Sie Ihre Technologie-Wahl entlang Ihrer geschäftlichen Anforderungen treffen – sei es in Sachen Robustheit, Iterationsgeschwindigkeit oder KI-Souveränität.
Die sinnvolle Unterscheidung zwischen KI-Workflows und Agents verstehen
KI-Workflows bieten eine vorhersehbare, kontrollierte Struktur für kritische Prozesse. KI-Agents setzen auf Flexibilität, zu Lasten der Zuverlässigkeit bei unvollständigen oder fehlerhaften Daten.
KI-Workflow: Struktur und Zuverlässigkeit
Ein KI-Workflow ist eine deterministische Abfolge von Schritten, die bereits in der Entwurfsphase definiert wird. Jeder Knoten steht für eine präzise Aufgabe – vom Aufruf einer API bis zur Verarbeitung einer Antwort. Durch Validierungsschleifen und Retry-Mechanismen wird sichergestellt, dass jede Information korrekt behandelt wird, bevor es weitergeht.
Dieser Ansatz eignet sich besonders, wenn die Datenvollständigkeit entscheidend ist, etwa für regulatorische Berichte oder automatisierte Abrechnungsprozesse. Das Verhalten bleibt nachvollziehbar, da jeder Pfad im Graphen im Voraus bekannt ist.
Indem man Schritte und Übergangsbedingungen klar strukturiert, minimiert man das Risiko stiller Fehler und kann jede Transaktion auditieren. Explizite Kontrollen ermöglichen zudem die Einbindung fachlicher Prüfungen, wie Toleranzgrenzen oder Cross-Checks.
KI-Agent: Anpassungsfähigkeit und Ungewissheit
Ein KI-Agent erhält ein übergeordnetes Ziel und eine Werkzeugliste. Er entscheidet in Echtzeit, ob er einen Service aufruft, ein Dokument überprüft oder mit einer Datenbank interagiert.
Diese Methode ist nützlich für explorative oder wenig strukturierte Aufgaben, bei denen ein festgelegter Funktionsablauf zu restriktiv wäre. Der Agent kann auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren und je nach Kontext das passende Werkzeug wählen.
Allerdings kann das Fehlen einer vordefinierten Struktur zu unvorhersehbaren Verhaltensweisen führen, insbesondere wenn Eingabedaten unvollständig oder fehlerhaft formatiert sind. Fehler können erst sehr spät sichtbar werden, nachdem der Agent einen ungeplanten Pfad beschritten hat.
Synthese und konkretes Anwendungsbeispiel
Für einen IT-Verantwortlichen lautet die zentrale Frage: Überwiegt die Beherrschbarkeit der Verarbeitungskette die Flexibilität? Wenn die Qualität systematische Validierungen erfordert, ist die Strenge eines Workflows der Agilität eines Agents vorzuziehen.
Ein Hersteller von Industriegeräten musste die Konformitätsprüfung seiner Bauteile automatisieren. Der Agent-Ansatz führte zu zu vielen Fehlalarmen und fehlender Nachvollziehbarkeit. Mit einem Workflow, der Rekalkulations-Schleifen und Evaluationsknoten umfasste, konnte er die Fehlerquote um 30 % senken und gleichzeitig eine lückenlose Prozessdokumentation gewährleisten.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Entscheidung jenseits von Marketingaussagen rein auf Ihren fachlichen Anforderungen beruhen sollte: Regeln, Retries und Datenvollständigkeit versus explorative Agilität.
Wann LangGraph bevorzugen: Maximale Kontrolle und Robustheit
LangGraph bietet ein Code-First-Framework zur Modellierung Ihrer Workflows als Graphen – bei vollkommener Freiheit. Ideal, wenn komplexe Geschäftslogik und Datenqualität strategische Anforderungen sind.
Vorstellung von LangGraph
LangGraph ist eine Open-Source-Bibliothek, die sich in Python oder JavaScript verwenden lässt, um Task-Graphen zu erstellen. Jeder Knoten kann eine API aufrufen, ein LLM ausführen oder Ergebnisse evaluieren.
Die Graph-Struktur erlaubt explizites Implementieren von Schleifen, Bedingungen und Retry-Mechanismen. Alles ist im Code definiert und gewährt vollständige Kontrolle über den Ausführungsfluss.
Dies erfordert Developer-Skills, liefert dafür aber volle Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit. Jede Transition ist versionierbar in Ihrem Git und testbar.
Fallbeispiel einer öffentlichen Behörde
Ein Projekt für eine Behörde sollte Fragen zum Gesetzgebungsprozess beantworten, ohne eine Vektor-Datenbank oder unkontrolliertes Crawling einzusetzen. Ein client-seitiges Rendering machte Scraping unmöglich.
Die Lösung bestand darin, alle OData-Entitäten im Prompt zu beschreiben und das LLM gültige URLs generieren zu lassen. Ein Knoten rief die OData-API auf, ein Evaluator prüfte die Datenvollständigkeit, bevor eine strukturierte Antwort formuliert wurde.
Fehlten Daten, sprang der Graph zur API-Abfrage zurück, ohne Duplikate zu erzeugen. Diese explizite Schleife wäre mit einem klassischen Agent kaum sauber umsetzbar gewesen.
Best Practices und Grenzen
LangGraph bietet maximale Kontrolle, erfordert aber genaue Planung von Fehlerpfaden und Management der Latenz. Mit vielen Verzweigungen kann der Code schnell unübersichtlich werden.
Automatische semantische Suche gibt es nicht: Prompts müssen sehr präzise sein, und Kontextvariablen streng definiert. Der Prototyp war nicht für den Produktiveinsatz gedacht, demonstrierte aber stabile Qualität und erklärbares Verhalten.
Kurzum: LangGraph glänzt dort, wo Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Robustheit unverhandelbar sind und Sie über ein Dev-Team verfügen, das die Komplexität beherrscht.
{CTA_BANNER_BLOG_POST}
LangFlow für schnelle Prototypen: Low-Code mit Kontrolle
LangFlow bietet eine Web-Interface mit Drag-&-Drop, um Workflows und Agents ohne Browserwechsel zusammenzustellen. Ideal für schnelle Iterationen, ergänzt um Code-Einbettung, wenn nötig.
Vorstellung von LangFlow
LangFlow ist kein No-Code, sondern ein Low-Code-Tool, das das Einfügen von Code in eine visuelle Oberfläche ermöglicht. Komponenten umfassen LLM-Aufrufe, individuelle Werkzeuge und modulare Sub-Flows.
Die Umgebung beinhaltet einen Editor, um Prompts anzupassen und kleine Skripte zu schreiben – ohne klassischen IDE-Overhead wie Git- oder Eclipse-Integration. Der Vorteil liegt in der schnellen Prototypenerstellung und der engen Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen.
Die Flows bleiben dabei meist linear, ohne echten Backtracking-Mechanismus. Sub-Flows können das Debugging erschweren und versteckte Abhängigkeiten erzeugen.
Fallbeispiel einer internen Organisation
Eine große Institution wollte Dialekt-Transkription und -Zusammenfassung von Schweizerdeutsch-Meetings automatisieren. Ziel war eine souveräne Infrastruktur, ohne Cloud oder SaaS.
Der LangFlow-Workflow bestand darin, die Audiodatei hochzuladen, Whisper zur Transkription aufzurufen, die API-Polling-Schleife bis zum Abschluss zu durchlaufen, den Text abzurufen und ans LLM zur Zusammenfassung zu übergeben. Alle Komponenten liefen lokal.
Innerhalb weniger Klicks entstand ein funktionsfähiger Prototyp, den die Teams noch am selben Tag testen konnten. Das Tool erwies sich für den internen Gebrauch als zuverlässig und war in weniger als 24 Stunden einsatzbereit.
Herausforderungen und Workarounds
Das Fehlen eines Backtracking erforderte Knoten-Duplikate oder zusätzliche Sub-Flows, um Umwege zu bauen. Das erhöhte die Komplexität des Diagramms und minderte die Übersichtlichkeit.
Für komplexere Abläufe mussten integrierte Agents oder ausgelagerte Code-Module herhalten, was die technische Konsistenz beeinträchtigte.
Fazit: LangFlow eignet sich ideal für schnelle POCs und einfache Flows, stößt aber an Grenzen, sobald mehrfache Validierungen und dynamische Korrekturen nötig sind.
Open WebUI: Eine souveräne Oberfläche für Ihre Workflows
Open WebUI stellt eine Open-Source-Plattform bereit, um Ihre Workflows als Chatbot zugänglich zu machen – mit Support für mehrere LLMs und externe Tools. Sie wandelt Graphen oder Flows in eine anwenderfreundliche UI um.
Funktionen von Open WebUI
Open WebUI bietet eine ChatGPT-ähnliche Experience, aber voll auto-hosted. Plugins, externe Tools, Dateiuploads und mehrere Modelle – lokal oder in der Cloud – werden unterstützt.
Diese UX-Schicht macht Workflows aus LangGraph oder LangFlow für Fachbereiche direkt nutzbar und liefert einen einheitlichen Einstiegspunkt.
Ein On-Premise-Rollout garantiert Daten-Souveränität sensibler Inhalte und verhindert Vendor-Lock-In.
Integrationsbeispiel in einer Behörde
Eine Verwaltung setzte Open WebUI ein, um juristische FAQs zu zentralisieren, die über einen LangGraph-Workflow generiert wurden. Mitarbeitende können Fragen stellen und den genauen Pfad jeder Antwort nachverfolgen.
Diese Transparenz schafft Vertrauen, insbesondere bei regulatorischen Fragestellungen. Die Robustheit von LangGraph sichert die Datenvalidität, während Open WebUI eine komfortable Nutzererfahrung liefert.
Dieses Setup zeigt, dass Kontrolle und Zugänglichkeit kombiniert werden können, ganz ohne proprietäre Lösungen.
Ausblick auf souveräne KI
Die Kombination aus Open WebUI, LangGraph und LangFlow bildet ein modulares, sicheres und skalierbares Ökosystem – ideal für interne Assistenten oder kundenorientierte Portale.
So entsteht eine Open-Source-Strategie ohne Vendor-Lock-In, zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden.
Beherrschen Sie Ihre KI-Workflows für Kontrolle und Agilität
Unsere Erfahrung zeigt: Es geht nicht um den Gegensatz Agents vs. Workflows, sondern um den Kompromiss zwischen expliziter Kontrolle und Iterationsgeschwindigkeit. Setzen Sie auf LangGraph, wenn komplexe Logik, intelligente Retries und vollständige Nachvollziehbarkeit gefragt sind. Wählen Sie LangFlow, um schnell lineare Flows zu prototypisieren oder interne Tools mit niedriger Kritikalität bereitzustellen.
Agents behalten ihren Platz in explorativen Szenarien, sollten jedoch in klare Workflows eingebettet werden. Open WebUI ergänzt dieses Portfolio mit einer souveränen UX-Schicht für Fachbereiche bei maximaler Sicherheit.
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit einem Edana-Experten