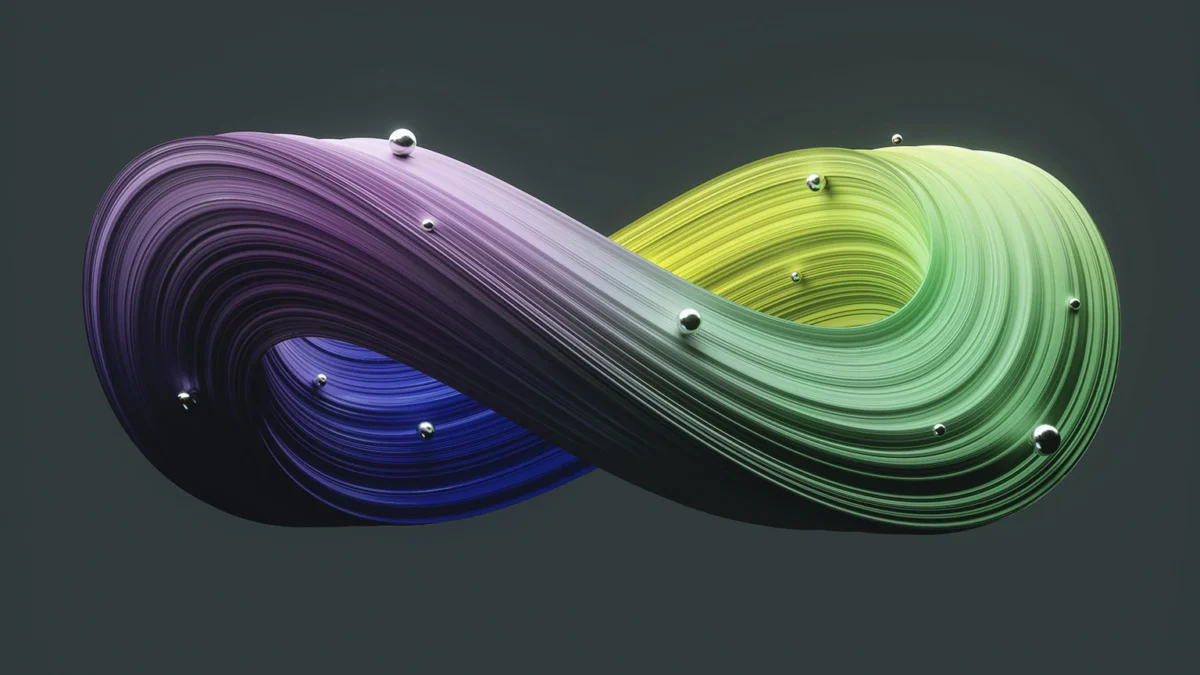In vielen Organisationen wird die Digitalisierung als Allheilmittel gegen Verzögerungen und wiederkehrende Fehler angesehen. Wenn jedoch ein Prozess von Unklarheiten, Inkonsistenzen oder überflüssigen Schritten betroffen ist, führt die Einführung eines digitalen Werkzeugs lediglich dazu, diese Schwachstellen offenzulegen und zu verstärken. Bevor eine Lösung implementiert wird, ist es unerlässlich, die operative Realität zu entschlüsseln: Umgehungsstrategien, informelle Anpassungen und implizite Abhängigkeiten, die im täglichen Arbeitsablauf entstehen.
Dieser Artikel zeigt, warum die Digitalisierung eines mangelhaften Prozesses Dysfunktionen verstärken kann und wie durch eine gründliche Analyse, Beseitigung von Reibungsverlusten und Vereinfachung eine echte digitale Transformation zu einem Hebel für Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit wird.
Den tatsächlichen Prozess verstehen, bevor man die Digitalisierung in Betracht zieht
Die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist die sorgfältige Beobachtung des Prozesses, wie er tatsächlich abläuft. Entscheidend ist nicht die theoretische Verfahrensanweisung, sondern die tägliche Ausführung.
Beobachtung vor Ort
Um die Abweichungen zwischen formalen Verfahren und der gelebten Praxis zu erfassen, ist es unerlässlich, die Nutzer in ihrem Arbeitsumfeld zu beobachten. Dies kann in Form von Interviews, Begleitungssitzungen („Shadowing“) oder der Analyse von Protokollen erfolgen.
Auf diese Weise sammeln die Beteiligten Berichte über Umgehungsstrategien, Tricks zur Beschleunigung einzelner Vorgänge und Verzögerungen durch ungünstige Freigaben. Jeder Hinweis vertieft das Verständnis des tatsächlichen operativen Ablaufs.
Diese Beobachtungsarbeit deckt häufig Umgehungsgewohnheiten auf, die in internen Handbüchern nicht erfasst sind und einen Teil der Verzögerungen oder wiederkehrenden Fehler erklären können.
Kartierung der Abläufe und Umgehungen
Bei der Kartierung werden die tatsächlichen Prozessschritte dargestellt, einschließlich Umleitungen und wiederholter manueller Dateneingaben. Sie ermöglicht die Visualisierung aller Interaktionen zwischen Abteilungen, Systemen und Dokumenten.
Durch das Überlagern des theoretischen Modells mit dem realen Ablauf lassen sich Schleifen erkennen, die ohne vorherige Klärung nicht automatisierbar sind. Die Kartierung macht so Engpässe und Verantwortungsbrüche sichtbar.
Beispiel: Ein Unternehmen aus dem Industriesektor hatte ein ERP-System zur Digitalisierung der Auftragsverwaltung eingeführt. Die Analyse offenbarte mehr als zwanzig manuelle Nacherfassungen, insbesondere beim Wechsel zwischen Vertrieb und Arbeitsvorbereitung. Dieses Beispiel zeigt, dass ohne Zusammenführung der Abläufe die Digitalisierung die Bearbeitungszeiten vervielfachte und die Arbeitsbelastung erhöhte.
Zeugen der täglichen Praxis
Über die formalen Abläufe hinaus ist es notwendig, die informellen Anpassungen der Anwender zu identifizieren, mit denen sie Fristen oder Qualität sicherstellen. Diese sogenannten „Workarounds“ sind Kompensationsmaßnahmen, die in die Überlegungen einbezogen werden müssen.
Die Erfassung dieser Praktiken offenbart mitunter Schulungsdefizite, Koordinationslücken oder widersprüchliche Vorgaben zwischen den Abteilungen. Werden diese Elemente ignoriert, werden die Dysfunktionen im digitalen Tool festgeschrieben.
Die Beobachtung der täglichen Praxis hilft zudem, implizite Abhängigkeiten von Excel-Dateien, informellen Absprachen oder internen Experten zu erkennen, die Inkonsistenzen ausgleichen.
{CTA_BANNER_BLOG_POST}
Unsichtbare Reibungspunkte identifizieren und beseitigen
Die auf dem Papier unsichtbaren Reibungspunkte werden bei der Analyse repetitiver Aufgaben sichtbar. Engpässe, Verantwortungsbrüche und Nacherfassungen zu identifizieren ist entscheidend, um eine Verschärfung der Dysfunktionen zu verhindern.
Engpässe
Engpässe entstehen, wenn bestimmte Prozessschritte den Arbeitsfluss blockieren und Warteschlangen verursachen. Sie verlangsamen die gesamte Kette und führen zu kumulierten Verzögerungen.
Ohne gezielte Maßnahmen wird die Digitalisierung diese Warteschlangen nicht reduzieren und kann sogar die Vorgänge im Vorfeld beschleunigen, was zu einer schnelleren Überlastung führt.
Beispiel: Eine Gesundheitsklinik hatte die Erfassung administrativer Anträge automatisiert. Allerdings blieb eine Abteilung die einzige, die Berechtigungen zur Freigabe der Akten besaß. Die Digitalisierung legte diesen einzigen Validierungspunkt offen und führte dazu, dass sich die Bearbeitungszeit von vier auf zehn Tage verlängerte, was den dringenden Bedarf an einer Verantwortungsverteilung verdeutlichte.
Verantwortungsbrüche
Wenn mehrere Akteure nacheinander eingreifen, ohne dass die Verantwortung für jeden Schritt eindeutig geklärt ist, entstehen Verantwortungsbrüche. Diese führen zu Rückschritten, Nachfragen und Informationsverlusten.
Eine präzise Kartierung der Verantwortungskette ermöglicht die eindeutige Zuordnung eines Ansprechpartners für jede Phase des Ablaufs. Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung vor jeglicher Automatisierung.
Ohne diese Klarheit droht das digitale System, die Zuständigkeiten hin- und herzuschieben und dabei Nachverfolgungsfehler zu erzeugen.
Nacherfassungen und unnötige Freigaben
Nacherfassungen entstehen häufig, um mangelnde Systeminteroperabilität auszugleichen oder Bedenken hinsichtlich der Datenqualität zu begegnen. Jede Nacherfassung ist redundant und fehleranfällig.
Freigaben hingegen werden oft „für alle Fälle“ verlangt, ohne tatsächliche Auswirkung auf die Entscheidungsfindung. Sie werden so zu einer überflüssigen administrativen Belastung.
Unnötige Nacherfassungen und Freigaben sind deutliche Hinweise auf organisatorische Dysfunktionen, die vor jeder Automatisierung behoben werden müssen.
Vereinfachen, bevor man automatisiert: Essentiell für ein nachhaltiges Projekt
Streichen Sie zunächst überflüssige Schritte und klären Sie die Rollen, bevor Sie Automatisierung hinzufügen. Ein gestraffter Prozess ist agiler zu digitalisieren und weiterzuentwickeln.
Entfernen redundanter Schritte
Bevor ein digitaler Workflow erstellt wird, müssen Aufgaben eliminiert werden, die keinen Mehrwert bieten. Jede Stufe wird hinterfragt: Dient sie wirklich dem Endergebnis?
Dies kann redundante Berichte, Papierausdrucke oder doppelte Kontrollen betreffen. Ziel ist es, nur die Aufgaben beizubehalten, die für Qualität und Compliance unabdingbar sind.
Diese Vereinfachung reduziert die Komplexität des künftigen Tools und erleichtert den Teams die Akzeptanz, da sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Klarstellung von Rollen und Verantwortlichkeiten
Sobald überflüssige Schritte entfernt sind, muss jede Aufgabe eindeutig einer Rolle zugewiesen werden. Dies vermeidet Unklarheiten, Nachfragen und unkontrollierte Verantwortungsübergaben.
Die Formalisierung der Zuständigkeiten schafft ein Vertrauensfundament zwischen den Abteilungen und ermöglicht den Einsatz effektiver Alarm- und Eskalationsmechanismen im System.
Beispiel: Ein E-Commerce-Mittelstandsunternehmen hatte seinen Rechnungsprozess neu strukturiert, indem es die Rolle jedes Mitarbeiters präzise festlegte. Die Klarstellung verringerte die Anzahl der Nachfragen um 40 % und schuf die Basis für ein reibungsloses, unterbrechungsfreies Automatisierungsmodul.
Standardisierung der Schlüsselaufgaben
Die Standardisierung zielt darauf ab, die Abläufe für wiederkehrende Aufgaben (Dokumenterstellung, automatisierte Versendung, Genehmigungsfollow-up) zu vereinheitlichen. Sie stellt die Konsistenz der Ergebnisqualität sicher.
Indem Formate, Nomenklaturen und Fristen standardisiert werden, erleichtert man die Integration mit anderen Systemen und die Erstellung konsolidierter Berichte.
Diese Vereinheitlichung ebnet den Weg für eine modulare Automatisierung, die sich an Veränderungen anpasst, ohne die Grundlagen infrage zu stellen.
Geschäftswert priorisieren, um Ihre Technologieentscheidungen zu steuern
Die Automatisierungsanstrengungen auf geschäftskritische Aktivitäten zu fokussieren, verhindert Überinvestitionen. Die Priorisierung leitet die Technologieauswahl und maximiert den Return on Investment.
Sich auf Kundenzufriedenheit konzentrieren
Prozesse, die direkt zur Kundenerfahrung oder Produktqualität beitragen, sollten prioritär automatisiert werden. Sie bieten einen sichtbaren und schnellen Nutzen.
Indem der Kunde im Mittelpunkt aller Überlegungen steht, stellt das Unternehmen sicher, dass die digitale Transformation den Markterwartungen in Bezug auf Reaktionsschnelligkeit und Zuverlässigkeit entspricht.
Dieser Ansatz verhindert, dass Ressourcen auf interne Nebenschritte verschwendet werden, die die Geschäftsentwicklung nicht direkt beeinflussen.
Auswirkungen messen und Prioritäten anpassen
Die Bewertung der erwarteten Vorteile basiert auf präzisen Kennzahlen: Durchlaufzeit, Fehlerquote, Stückkosten oder Kundenzufriedenheit. Diese Metriken steuern die Projektphasen.
Ein KPI-basiertes Controlling ermöglicht es, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und den Fahrplan anzupassen, bevor die Automatisierung auf weitere Bereiche ausgeweitet wird.
Das Automatisierungsniveau am erwarteten ROI ausrichten
Nicht alle Prozesse erfordern das gleiche Automatisierungsmaß. Leichte Mechanismen wie automatisierte Benachrichtigungen genügen oft, um den Ablauf zu optimieren.
Für Aktivitäten mit geringem Volumen oder hoher Variabilität kann eine halbautomatisierte Lösung, die digitale Werkzeuge mit menschlichem Eingreifen kombiniert, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten.
Diese angepasste Dimensionierung bewahrt die Flexibilität und verhindert, dass Prozesse eingefroren werden, die sich mit dem Geschäftskontext weiterentwickeln.
Ihre Prozesse in Effizienztreiber verwandeln
Die Digitalisierung darf nicht darin bestehen, einen fehlerhaften Prozess einfach in ein Tool zu übertragen. Sie muss auf einer realistischen Analyse, der Beseitigung von Reibungsverlusten und einer Vorabvereinfachung beruhen. Die Priorisierung entlang des Geschäftswerts garantiert eine Steuerung über die Leistung und nicht nur über die Technologie.
Bei Edana begleiten unsere Expertinnen und Experten Schweizer Unternehmen in diesem strukturierten und kontextbezogenen Ansatz, der auf Open Source, Modularität und Sicherheit basiert. Sie helfen dabei, Prozesse zu klären, Werttreiber zu identifizieren und die passenden Lösungen für jeden Anwendungsfall auszuwählen.
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit einem Edana-Experten