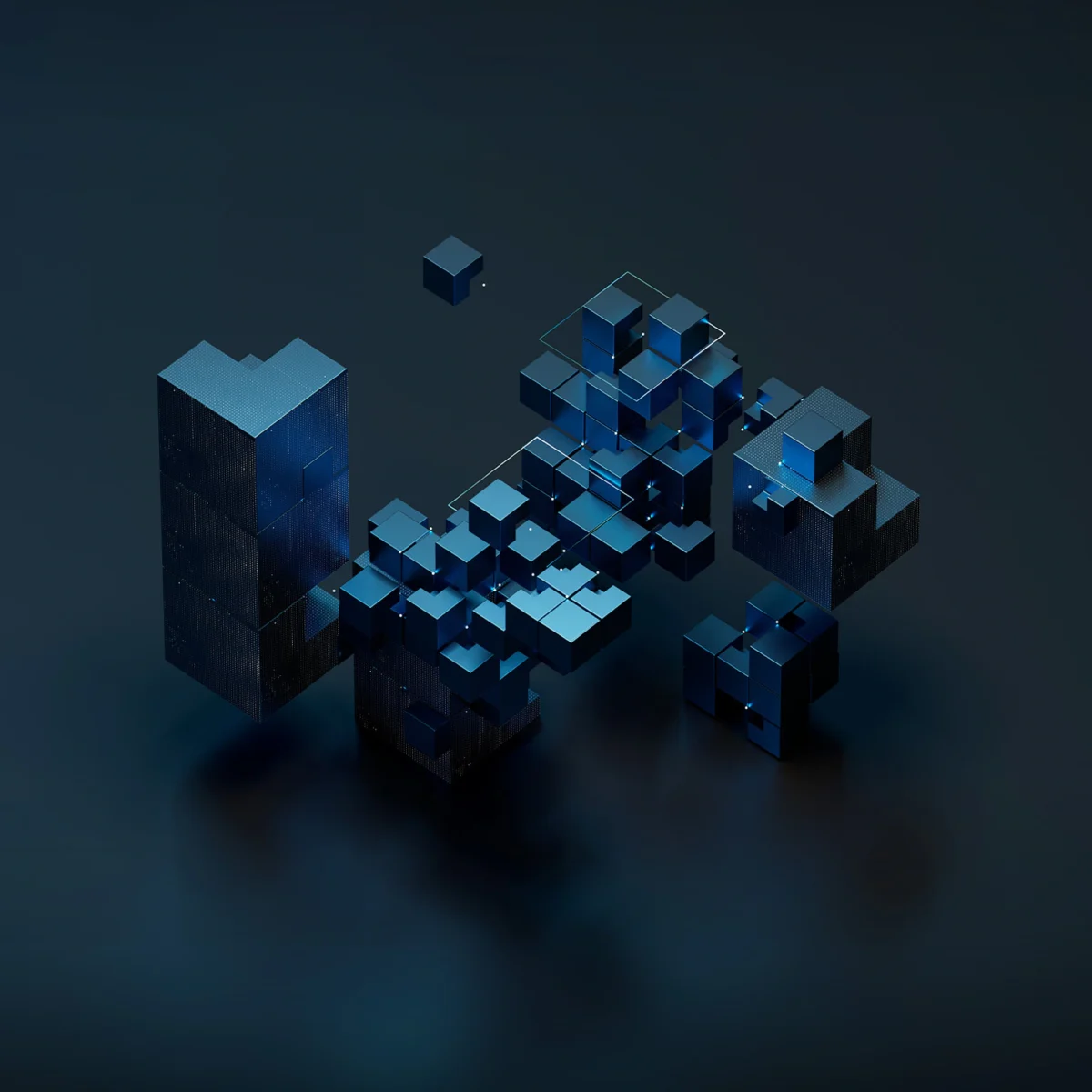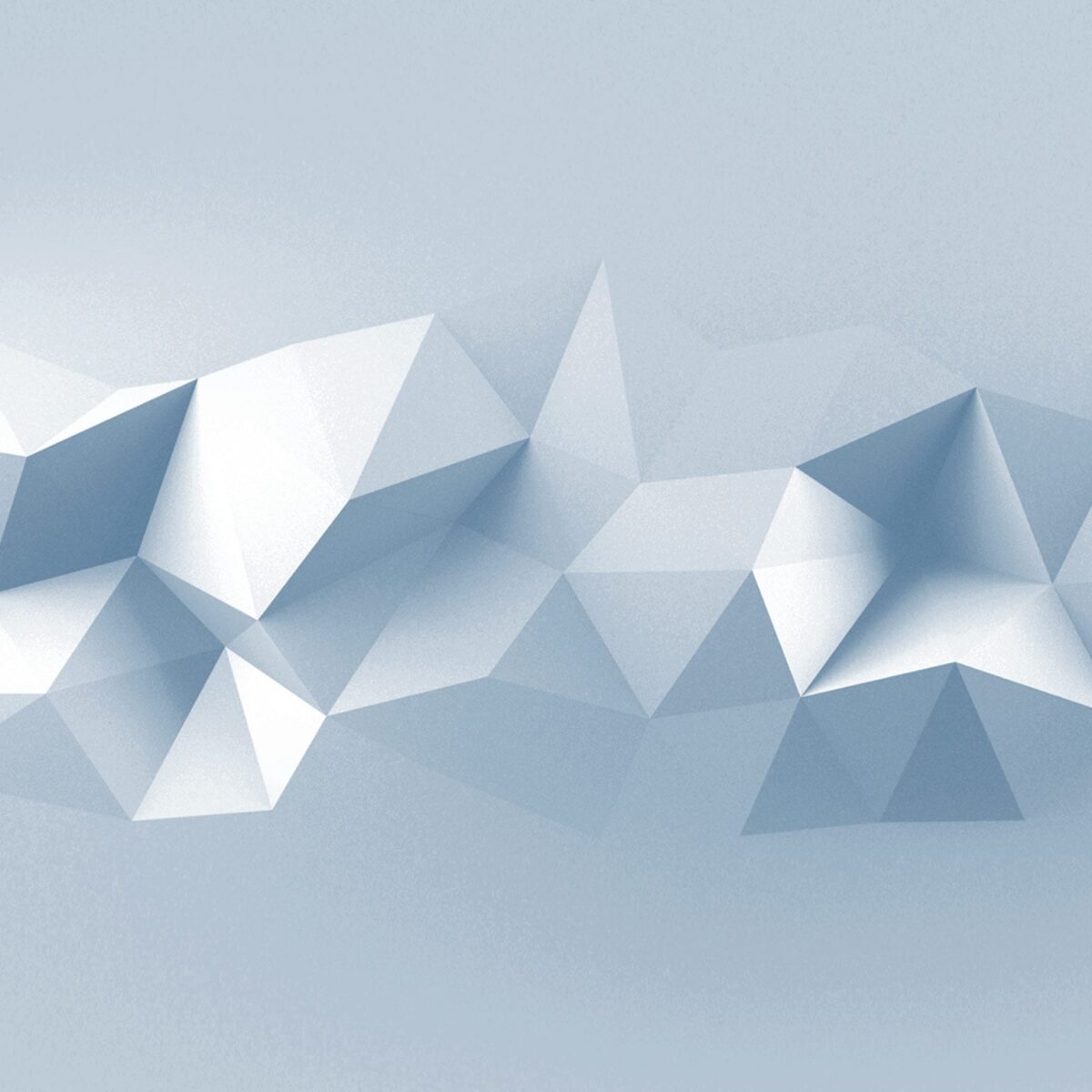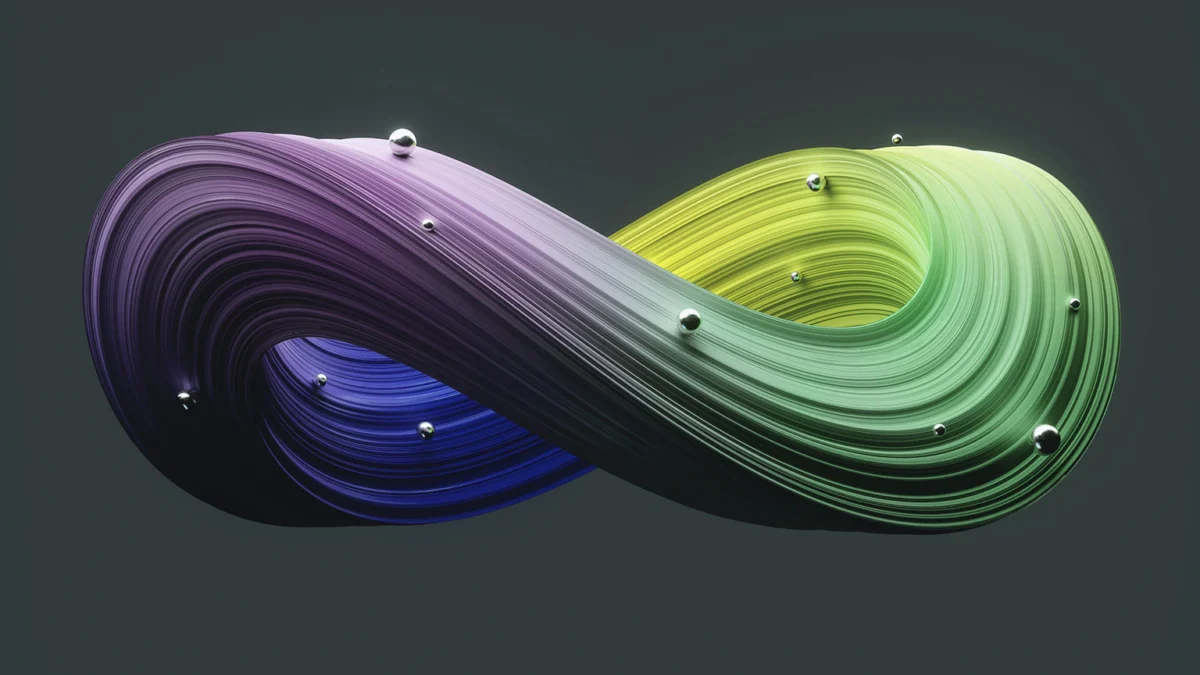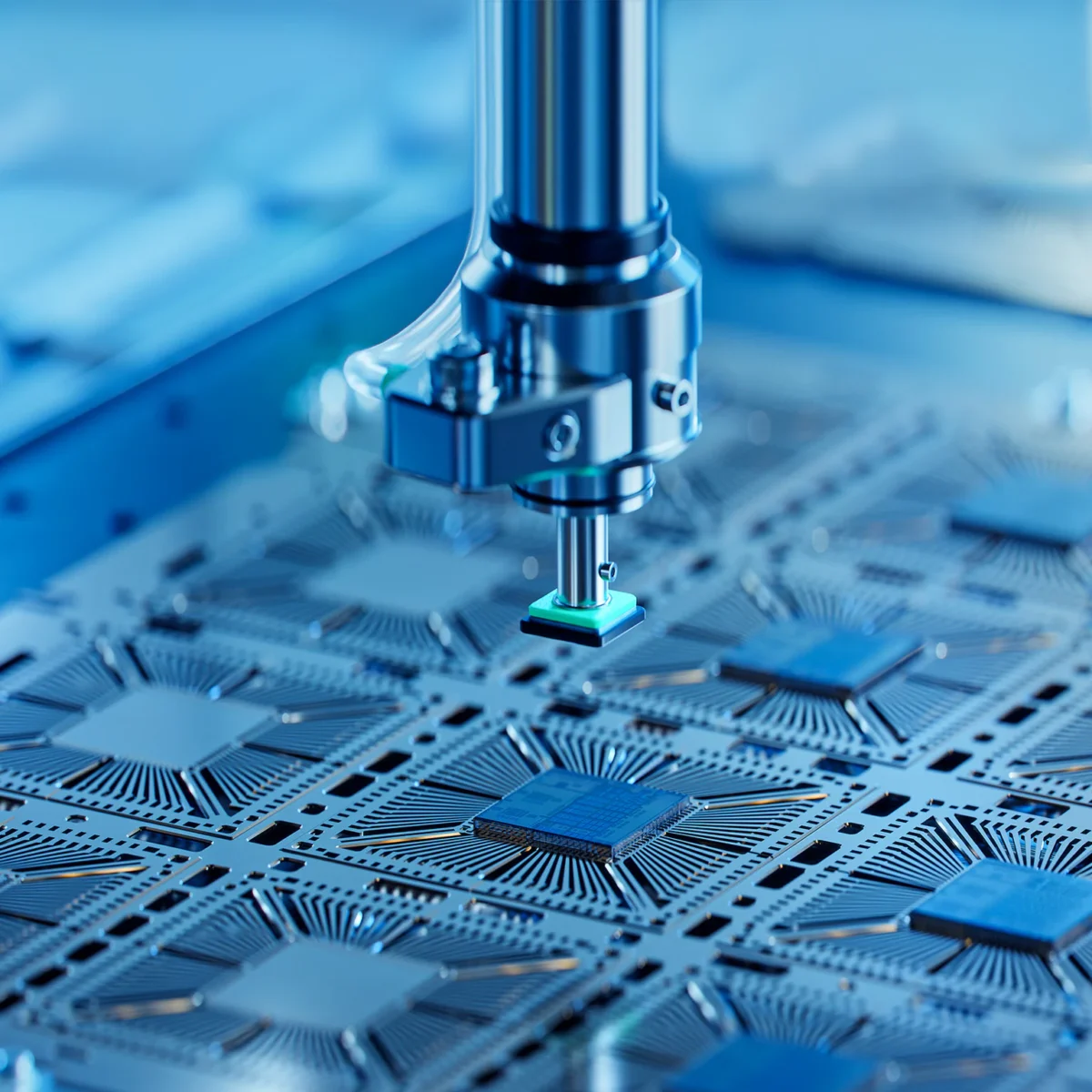Moderne Data Lakes beschränken sich nicht mehr auf die Ansammlung von Dateien, sondern etablieren sich als umfassende Plattformen, die in der Lage sind, große heterogene Datenmengen im Schema-on-Read-Modus zu ingestieren, zu speichern, zu transformieren, zu orchestrieren und abzufragen.
Um einen Datensumpf zu vermeiden, ist es unerlässlich, von Anfang an eine modulare Architektur mit klar definierten Zonen (Bronze, Silver, Gold, Sandbox), eine strenge Governance und nachverfolgbare Prozesse festzulegen. Open Source bietet hier einen doppelten Vorteil: die Neutralisierung von Vendor-Lock-in und die unabhängige Weiterentwicklung der Speicher-, Berechnungs- und Abfragekomponenten. Bevor ein Industrialisierungsprojekt startet, sollte ein IT-/Finanzkomitee sowohl Einsparungen bei Lizenzkosten als auch Integrations-, Wartungs- und Schulungskosten sorgfältig abwägen.
Grundlagen für einen modernen Data Lake schaffen
Eine agile Datenstruktur basiert auf kontinuierlicher Ingestion und spaltenoptimiertem Speicher. Das Schema-on-Read beschleunigt die Bereitstellung und minimiert Vortransformationen.
Skalierbare Ingestionsstrategien
Um verschiedene Datenquellen (operative Datenbanken, IoT, Anwendungslogs) aufzunehmen, ist die Kombination aus Streaming-Tools (Kafka, Debezium) und datenstromorientierten Pipelines (NiFi) essenziell. Dieser Ansatz gewährleistet schnelle und zuverlässige Replikation bei gleichzeitiger Bewahrung des rohen Ereignisverlaufs. Weitere Details finden Sie in unserem Vergleich der iPaaS-Konnektoren.
Kafka übernimmt das Queuing und Buffering der Daten, während Debezium Schemaänderungen in transaktionalen Datenbanken erfasst. NiFi bietet eine visuelle Oberfläche zum Orchestrieren, Filtern und Anreichern von Datenströmen, ohne spezifischen Code entwickeln zu müssen.
Ein mittelständisches Schweizer Industrieunternehmen hat Kafka und NiFi eingesetzt, um in Echtzeit Daten aus Automatisierungssystemen und dem ERP zu gewinnen. In diesem Szenario landen die Rohdaten in der Bronze-Zone, was vollständige Audits und Resilienz gegen Lastspitzen sicherstellt.
Objektspeicher und spaltenbasierte Formate
S3-kompatible Lösungen (MinIO, Ceph) kombiniert mit spaltenoptimierten Formaten (Parquet, ORC, Avro) bilden das Rückgrat des Speichers. Sie ermöglichen schnelle Lesezugriffe und effiziente Kompression, was die Infrastrukturkosten senkt.
MinIO und Ceph, on-premise oder in einer privaten Cloud, bieten die erforderliche horizontale Skalierbarkeit für Petabyte-Datenbestände. Spaltenformate gliedern Daten nach Feldern und komprimieren Bereiche mit niedriger Kardinalität, was die Analyseperformance steigert.
Parquet ermöglicht selektive Spaltenzugriffe, reduziert die Festplatten-E/A und beschleunigt die Antwortzeiten. Avro dient häufig für den Datenaustausch zwischen Services, da es Schemaevolution nativ unterstützt.
Medallion-Architektur für die initiale Strukturierung
Der Medallion-Ansatz unterteilt den Data Lake in separate Zonen: Raw/Bronze für unstrukturierte Rohdaten, Processed/Silver für bereinigte und angereicherte Daten, Curated/Gold für fachlich aufbereitete Daten sowie Sandbox für exploratives Arbeiten. Diese Struktur verhindert Verwirrung und Datensumpf.
In der Bronze-Zone werden Daten in ihrem ursprünglichen Format gespeichert. Die Silver-Zone wendet Qualitäts-, Bereinigungs- und Standardisierungsregeln an, während die Gold-Zone aggregierte Tabellen und fachlich definierte Views bereitstellt.
Die Sandbox ist Data Scientists und Analysten vorbehalten, damit sie neue Modelle entwickeln können, ohne den Produktionsbetrieb zu beeinträchtigen. Jede Zone verfügt über eigene Zugriffsrichtlinien und Lebenszyklusregeln, um Aufbewahrung und Sicherheit zu optimieren.
Orchestrierung und großmaßstäbliche Verarbeitung
Ein einheitlicher Daten-Pipeline verbindet Batch- und Streaming-Verarbeitung, um analytische und operative Anforderungen abzudecken. Eine robuste Orchestrierung gewährleistet Reproduzierbarkeit und Nachverfolgbarkeit der Workflows.
Vereinheitlichte Batch- und Streaming-Verarbeitung
Apache Spark und Apache Flink bieten Engines, die sowohl Batch- als auch Streaming-Jobs abdecken. Spark Structured Streaming und Flink DataStream vereinheitlichen die APIs, was die Entwicklung vereinfacht und technische Schulden reduziert.
Durch diese Konvergenz lässt sich ein Job im Batch-Modus testen und anschließend im Streaming-Modus ohne größere Anpassungen deployen. Das Schema-on-Read erlaubt es, dieselben Transformationsregeln auf Echtzeit- und historische Daten anzuwenden.
Eine große Schweizer Einzelhandelskette implementierte Spark Structured Streaming, um ihre täglichen Verkaufszahlen zu aggregieren und Retouren in nahezu Echtzeit zu verarbeiten. Dadurch verringerte sich die Berichtszeit um mehrere Stunden, und die Logistikteams reagierten deutlich schneller.
Orchestrierung und Automatisierung der Pipelines
Airflow und Dagster orchestrieren Workflows über DAGs, in denen Abhängigkeiten, Zeitpläne und Fehlerbehandlungsregeln definiert sind. Sie bieten Wartungsfunktionen, Alarmierung und zentrale Logs für jede Ausführung. Erfahren Sie, wie Platform Engineering diese Orchestrierung verstärken kann.
Airflow verfügt über ein ausgereiftes Ökosystem, vielfältige Konnektoren und eine leistungsstarke Überwachungsoberfläche. Dagster setzt stärker auf Code-Qualität, Versionierung und native Beobachtbarkeit der Pipelines.
Insbesondere in Industrieumgebungen sind programmatische Planung und Prioritätensetzung entscheidend, um SLAs einzuhalten. Orchestrierungstools bieten Retry-, Backfill- und Self-Healing-Mechanismen, um die Zuverlässigkeit zu steigern.
Interaktive Abfrage und Exploration
Verteilte Query-Engines wie Trino (Presto), Dremio oder ClickHouse liefern interaktive Performance auf Petabyte-Daten. Sie verbinden sich direkt mit den Silver- und Gold-Zonen, ohne die Daten in großem Umfang zu kopieren.
Trino zerlegt Abfragen in parallel auszuführende Fragmente, während ClickHouse Kompression und Indexierung für ultraschnelle Scans optimiert. Lakehouse-Ansätze mit Apache Iceberg oder Delta Lake verbessern Metadaten- und Transaktionsmanagement.
Self-Service-Abfragen ermöglichen Fachbereichen Ad-hoc-Analysen in Sekundenschnelle, ohne das Data-Engineering-Team zu involvieren. Die Performance bleibt auch bei hoher Last konstant.
{CTA_BANNER_BLOG_POST}
Governance, Sicherheit und Nachverfolgbarkeit: Den Datensumpf vermeiden
Ohne straffe Governance und feinkörnige Zugriffskontrollen verwandelt sich ein Data Lake schnell in einen Datensumpf. Die Nachverfolgung von Datenflüssen und Transformationen ist essenziell für Compliance und Zuverlässigkeit.
Katalogisierung und Data Discovery
DataHub und Amundsen zentralisieren Metadaten, Schemata, Dokumentation und Lineage, um die Auffindbarkeit und Verständlichkeit der Datenbestände zu erhöhen. Sie bieten Suchfunktionen, Beziehungsgraphen und APIs für Abfragen.
Jede Tabelle, jede Datei und jede Pipeline veröffentlicht Metadaten bereits beim Schreiben. Data Stewards können Datensätze annotieren, klassifizieren und nach Sensibilität und Fachbereichsnutzen bewerten.
Ein Schweizer öffentlicher Dienst nutzte Amundsen, um seine Open-Data-Tabellen zu inventarisieren und Transparenz über Eigentümer, Aktualisierungsfrequenz und Änderungsverlauf zu schaffen. Das Projekt senkte Supportanfragen aufgrund unbekannter Datenquellen um 40 %.
Sicherheit und Zugriffskontrolle
Apache Ranger und Knox setzen Sicherheitsrichtlinien auf Objektebene (Dateien, Tabellen) und für API-Zugriffe um. Sie verwalten Authentifizierung, Autorisierung sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung. Eine mehrschichtige Security-Architektur verstärkt die Abwehr.
Ranger definiert feingranulare Regeln auf Basis von Benutzerattributen, Gruppen und Ausführungskontext, während Knox als einheitliches Gateway externe Aufrufe filtert und überwacht. Detaillierte Audits protokollieren jede Abfrage und Änderung.
Eine kantonale Schweizer Behörde implementierte Ranger, um den Zugriff auf sensible medizinische Daten zu siloieren. So erfüllte sie regulatorische Vorgaben und konnte bei Kontrollen unmittelbar Audit-Berichte vorlegen.
Observability und Monitoring
Prometheus, Grafana und der ELK-Stack liefern Metriken, Logs und Traces zur Überwachung der Integrität und Performance des Data Lakes. Sie identifizieren Flaschenhälse, Ingestionsfehler und Schema-Drifts. Best Practices aus DevSecOps sind hierbei unverzichtbar.
Prometheus sammelt Zähler und Histogramme von Servern und Jobs, Grafana visualisiert Echtzeit-Dashboards, und ELK indexiert Anwendungslogs für schnelle, tiefgehende Analysen im Fehlerfall.
In der Produktion warnt ein zentrales Dashboard automatisch bei CPU-Überschreitungen, Pipeline-Ausfällen oder hoher Abfragelatenz. Diese Reaktionsfähigkeit ist entscheidend, um das Vertrauen der Fachbereiche zu erhalten.
Open Source-Modularität und Kostensteuerung
Der Einsatz unabhängiger Open Source-Komponenten erlaubt es, Speicher, Berechnung und Abfrage unabhängig voneinander weiterzuentwickeln. Das reduziert Lizenzkosten und schafft ein austauschbares Ökosystem.
Entkopplung von Storage, Compute und Query
Die Formate Iceberg, Delta Lake und Hudi bieten Versionierung, transaktionale Tabellen und Time-Travel-Funktionen, ohne Speicher und Engine proprietär zu koppeln. So lässt sich der Berechnungs-Engine wechseln, ohne Daten zu migrieren. Siehe unseren Guide Auswahl der Data-Plattform.
Iceberg trennt das Metadaten-Catalog vom Speicher und erleichtert Optimierungen bei Partitionierung und Indexierung. Delta Lake, entwickelt von Databricks, stellt ACID-Sicherheit und Vacuum-Funktionen zum Aufräumen alter Dateien bereit.
Durch diese Entkopplung lässt sich schrittweise innovieren: Man kann mit Spark starten, für spezifische Aufgaben auf Flink wechseln und für Abfragen schließlich Trino oder ClickHouse einsetzen, ohne eine komplette Neuimplementierung.
Auswahl von Open Source-Komponenten
Die Wahl der Tools richtet sich nach Volumen, Latenzanforderungen und den internen Kompetenzen. Kafka, Spark, Flink, Airflow, Trino, Iceberg, Ranger und DataHub bilden ein bewährtes, modulares Set.
Diese Zusammenstellung verhindert Vendor-Lock-in und profitiert von einer aktiven Community für Updates, Sicherheitspatches und Support. Jede Komponente kann bei Bedarf ersetzt werden, sobald ein geeignetes Projekt verfügbar ist.
Die Auswahl erfolgt nach einem Proof of Concept, in dem Betriebskosten, Performance und Lernkurve für das Team verglichen werden.
Finanzielle Governance: TCO und Fähigkeiten
Open Source-Lizenzen sind kostenfrei, doch Integration, Monitoring und Wartung erfordern spezifisches Know-how. Die Gesamtkosten der Datenplattform beinhalten Cluster-, Speicher-, Netzwerk-, Schulungs- und Supportkosten.
Ein CIO/CDO-/Finance-Komitee muss diese Betriebskosten antizipieren und einen Plan für Skill-Building oder Rekrutierung vorsehen. Dienstleister können als Sparringspartner die Skalierung beschleunigen.
Ein IT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz migrierte sein proprietäres Data Warehouse auf eine Architektur mit Iceberg und Trino. Es erzielte 70 % Einsparungen bei Lizenzkosten und investierte gleichzeitig in Schulungen und einen Supportvertrag zur Absicherung des Betriebs.
Starten Sie die Industrialisierung Ihres modernen Data Lakes
Ein industriereifer Data Lake basiert auf vier Säulen: kontinuierliche Ingestion und klare Bronze-/Silver-/Gold-Zonen, vereinheitlichte Batch- und Streaming-Verarbeitung mit Orchestrierung, strikte Governance für Sicherheit und Nachverfolgbarkeit sowie modulare Open Source-Komponenten zur TCO-Kontrolle. Gemeinsam verhindern diese Entscheidungen den Datensumpf und sichern Skalierbarkeit, Performance und Resilienz Ihrer Datenplattform.
Ob Proof of Concept oder umfassende Strategieentwicklung: Unsere Edana-Experten begleiten Sie dabei, diesen Blueprint an Ihre fachlichen und technischen Anforderungen anzupassen. Lassen Sie uns über Ihre Herausforderungen sprechen und die optimale Lösung zum Freisetzen des Werts Ihrer Daten konzipieren.
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit einem Edana-Experten