Zusammenfassung – Die Schadenbearbeitung leidet unter fragmentierten Systemen, manuellen Betrugskontrollen auf unstrukturierten Daten und einem mangelhaften Kundenprozess, was zu längeren Bearbeitungszeiten, Mehrkosten und Unzufriedenheit führt. Lösung: Umstieg auf eine modulare, datengetriebene Plattform – Event-Bus und Microservices verknüpfen APIs, NLP und Computer Vision für proaktive Betrugserkennung, zentralisierte Governance und eine Omnichannel-UX mit transparentem, reaktionsschnellem Tracking.
Die Schadenbearbeitung ist für Versicherer ein strategischer Faktor, der die Schnelligkeit der Regulierung, Kostenkontrolle und das Vertrauen der Versicherten maßgeblich beeinflusst. Trotz des Vormarschs von Automatisierungs- und KI-Technologien tun sich viele Anbieter schwer, vom reinen datenbasierten Reporting zu einem datengetriebenen Vorgehen zu wechseln, das Entscheidungen in Echtzeit orchestriert und individualisierte Abläufe ermöglicht.
Dieser Artikel beleuchtet die drei größten Hemmnisse – die Systemfragmentierung, die Grenzen der Betrugserkennung in unstrukturierten Daten und der mangelnde Fokus auf das Kundenerlebnis – und stellt die Hebel vor, mit denen eine nachhaltige Transformation eingeleitet werden kann. Ziel ist es, operative Effizienz, Datenverlässlichkeit und Kundenzufriedenheit in Einklang zu bringen.
Fragmentierung von Systemen und Daten
Applikationssilos schaffen zahlreiche Schnittstellen und beeinträchtigen die Prozesskohärenz. Heterogene Datenflüsse erfordern komplexe Brücken und verzögern die Umsetzung einer nahtlosen Automatisierung.
Applikationssilos und starre Schnittstellen
In vielen Versicherungsgesellschaften basieren die Schaden-Workflows auf Altsystemen und spezialisierten Standardlösungen. Jede Komponente stellt eigene APIs oder Exportformate bereit, sodass individuelle Konnektoren entwickelt werden müssen. Dieses technische Mosaik erschwert die Wartung und birgt bei jeder Versionserneuerung Ausfallrisiken.
Die Vielzahl an ETL-Prozessen und Transformationsskripten erhöht die Latenz und verkompliziert das Monitoring. Ohne eine einheitliche Orchestrierungsebene ist eine End-to-End-Automatisierung kaum realisierbar. Im Störfall sind die Teams oft nicht in der Lage, die Ursache für Verzögerungen – Datenbank, Message-Bus oder Drittservice – eindeutig zu identifizieren.
Dieser Effekt zieht eine Dominowirkung nach sich: Jede neue oder aktualisierte Komponente erfordert umfangreiche Abnahmetests, was die Deployment-Frequenz bremst und die Time-to-Market bei Prozessänderungen verlängert.
Vielfalt an Formaten und Datenquellen
Bei Schäden fallen unterschiedlichste Daten an: strukturierte Formulare, Bilddateien, freie PDF-Berichte, Sprachaufzeichnungen und Sensordaten aus dem IoT. Ohne ein einheitliches Format erfordert die Konsolidierung manuelle oder halbautomatisierte Workflows, die zeit- und ressourcenintensiv sind.
Fehlt ein Master Data Management (MDM), bleiben Performance-Kennzahlen ungenau, was die Qualität von Dashboards beeinträchtigt und proaktive Entscheidungen zur Kostensteuerung oder Anomalieerkennung erschwert.
Auswirkungen auf Time-to-Market und Servicequalität
Wenn die Datenabstimmung manuell oder semi-automatisiert erfolgt, verlängern sich die Schadenprozesse, was das Kundenerlebnis belastet. Die durchschnittlichen Bearbeitungskosten steigen, obwohl eine zügige Regulierung heute ein wesentlicher Differenzierungsfaktor ist.
Pilotprojekte zur punktuellen Automatisierung (z. B. eines einzelnen Services oder Formats) erzielen oft nicht die erwarteten Effizienzgewinne, da eine übergreifende Vision fehlt. Versicherer berichten von begrenzten Produktivitätszuwächsen und nach wie vor hohen Fehlerraten.
Für eine nachhaltige Automatisierung ist es daher unerlässlich, die Anwendungsarchitektur auf eine modulare Plattform auszurichten, die neue Komponenten problemlos aufnimmt und den Datenaustausch konsistent gestaltet, ohne das Ökosystem zu blockieren.
Betrugserkennung in unstrukturierten Daten
Betrugsfälle generieren vielfältige, häufig nicht indexierte Daten und erfordern fortgeschrittene Analysefähigkeiten. Manuelle Prozesse decken nur einen Teil der schwachen Signale ab.
Multiforme Betrugsmuster in der Schadenversicherung
Betrugsversuche äußern sich verschieden: ungenaue Angaben, fingierte Großschäden, manipulierte Rechnungen oder Doppelabrechnungen. Die Belege können gefälscht oder aus unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt sein.
Während einfache Regeln (z. B. Beträge über einem Schwellenwert) manches entdecken, basieren viele Betrugsfälle auf komplexen Hinweisen: Datumskonflikte, verdächtige Fotobearbeitung oder Diskrepanzen zwischen Geodaten und Schadensort.
Die Variabilität dieser Muster macht statische Regelwerke unzureichend. Ohne semantische Analyse und Machine Learning nutzen Betrüger die Lücken traditioneller Prozesse schamlos aus.
Grenzen manueller Prozesse und nachträglicher Analyse
In vielen Unternehmen erfolgt die Prüfung der Belege noch manuell oder per einfacher OCR-Skripte. Die Betrugserkennung bleibt so auf eine nachgelagerte Kontrolle beschränkt, die spät ansetzt und ineffizient ist.
Teams geraten bei hohem Schadenaufkommen, etwa nach Unwettern oder Großschäden, schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Kontrolleure müssen priorisieren, sodass risikobehaftete Fälle unentdeckt bleiben können.
Liegt keine KI-Schicht vor, die Texte, Bilder und Metadaten automatisch analysiert, führen spät erkannte Anomalien zu Nachfragen, Rückrufen und im schlimmsten Fall zu Rechtsstreitigkeiten. Das belastet die Kundenbeziehung und treibt die Verwaltungskosten in die Höhe.
Beitrag der künstlichen Intelligenz bei unstrukturierten Daten
NLP-Modelle (Natural Language Processing) und Computer-Vision-Verfahren können heute Gutachten scannen, Inkonsistenzen identifizieren und die Dokumentenzuverlässigkeit in Echtzeit bewerten. Die KI klassifiziert und priorisiert Fälle nach Risikoscoring.
Ein Schadenversicherer steuerte seine Betrugserkennung bislang in Excel, indem jedes Element manuell verknüpft wurde. Nach Einführung einer intelligenten Analyse-Engine verdoppelte sich der Anteil hochriskanter Schadensfälle, während der manuelle Prüfaufwand um 30 % sank. Dieses Erfahrungsbeispiel zeigt, wie proaktive Erkennung an Genauigkeit und Geschwindigkeit gewinnt.
Eine intelligent modulare Automatisierung kombiniert diese Algorithmen mit fachlichen Regeln, um zielgerichtete Untersuchungen auszulösen, ohne den Standardprozess zu verlangsamen, und steigert so die Effizienz der Prüfteams.
Edana: Strategischer Digitalpartner in der Schweiz
Wir begleiten Unternehmen und Organisationen bei ihrer digitalen Transformation.
Mangelnder Fokus auf das Kundenerlebnis
Schadenprozesse bleiben häufig fragmentiert und intransparent, was Frustration und Unzufriedenheit erzeugt. Automatisierung muss ebenso omnichannel-fähig und nutzerorientiert gestaltet sein.
Kundenerwartungen und Branchenstandards
Heute erwarten Versicherte eine Echtzeit-Verfolgung ihres Antrags, klare Benachrichtigungen und unmittelbare Interaktionen. E-Commerce- und Finanzdienstleistungen setzen einen hohen Reaktivitätsstandard.
Fehlen integrierte Oberflächen, muss der Kunde die Hotline anrufen, warten und mehrfach dieselben Informationen preisgeben. Dieses suboptimale Erlebnis fördert das Gefühl, „alleingelassen“ zu werden, und wirkt sich negativ auf den Net Promoter Score (NPS) aus.
Innovative Versicherer bieten bereits Apps mit Chatfunktion, Dokumentenablage und interaktivem Verlauf an und orchestrieren im Hintergrund automatisch alle Bearbeitungsschritte.
Intransparenter Schadenprozess
Ist die Back-Office-Infrastruktur nicht mit der Kundenplattform verbunden, erfolgt jede Aktualisierung manuell: CRM-Eingabe, E-Mail-Versand, Portalaktualisierung. Diese Verzögerungen wirken sich direkt auf die Zufriedenheit aus.
Die fehlende Statussichtbarkeit führt zu erhöhten Anruf- und E-Mail-Volumina, überlastet den Support und verlängert die Bearbeitungszeiten.
Ohne automatische Statusrückmeldung sind Zufriedenheitsanalysen ungenau und Korrekturmaßnahmen verspätet. Proaktive Benachrichtigungen (Push, E-Mail, SMS) reduzieren den menschlichen Aufwand und stärken die Kundenbindung.
Self-Service-Portale und Chatbots als Autonomieschritte
Self-Service-Portale und Chatbots, die einfache Anfragen verstehen, senken redundante Supportanfragen und geben Versicherten mehr Gelassenheit. In digitalen Abläufen erzeugt jeder Schritt ein Ereignis, das die KI auslöst.
Ein E-Commerce-Anbieter setzte einen mehrsprachigen Chatbot im Kundenservice ein. Die Rate automatisch gelöster Anfragen stieg um 40 %, während Status-Anfragen um 55 % zurückgingen. Dieses Beispiel belegt, dass Kundenerlebnisse durch nutzerzentrierte Automatisierung deutlich verbessert werden.
In Kombination mit einer intelligenten Workflow-Engine wird der Prozess gemäß Kundenprofil und fachlichen Regeln personalisiert und kommuniziert kontextbezogen (SMS, E-Mail, Push), ganz ohne manuelle Eingriffe.
Hebel für die Transformation
Eine datengetriebene Vorgehensweise, gekoppelt mit modularer Architektur und konsequenter Datengovernance, bildet die Grundlage für eine leistungsfähige und skalierbare Schadenbearbeitung. KI und smarte Automatisierung spielen dabei eine zentrale Rolle.
Intelligente Automatisierung und proaktive Betrugserkennung
Durch die Kombination von NLP-Microservices und Computer-Vision-Modulen lassen sich Verarbeitungsketten implementieren, die jede eingereichte Unterlage fortlaufend evaluieren. Prädiktive Modelle alarmieren Kontrollteams sofort bei Risikofällen.
Der Einsatz von Open-Source-Frameworks (TensorFlow, PyTorch) sichert technologische Unabhängigkeit und ermöglicht die Weiterentwicklung der Modelle bei neuen Betrugsmustern. Die Integration in CI/CD-Pipelines beschleunigt den Datensatz-Iterationen und optimiert die Performance.
Diese smarte Automatisierung steigert die Produktivität, reduziert False Positives und entlastet die Teams, damit sie sich auf komplexe Fälle konzentrieren können, während die Erkennungszuverlässigkeit steigt.
End-to-End-Vision und modulare Architektur
Eine Schadenbearbeitungsplattform sollte als hybrides Ökosystem verstanden werden, das bewährte Komponenten und maßgeschneiderte Entwicklungen vereint. Ein Event-Bus (Kafka, RabbitMQ) sorgt für kohärente Service-Interaktionen und fördert lose Kopplung.
Ein mittelständischer Industriebetrieb stellte seine Architektur auf Microservices um und trennte Dokumentenmanagement, Schadensbewertung und Abrechnung. Diese Modularität verringerte systemische Ausfallzeiten um 60 % und beschleunigte die Integration neuer Datenkanäle – ein überzeugender Beleg für den Nutzen einer einheitlichen Architektur.
Standardisierte APIs und Contract-Driven Development (CDD) gewährleisten robuste Integrationen, reduzieren Wartungsaufwand und verhindern Vendor Lock-In.
Datengovernance und datengetriebene Kultur
Ein zentraler Data Lake oder Data Warehouse in Kombination mit einem Datenkatalog und klaren Governance-Regeln sichert Datenverlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Jede Schadensinformation wird so zur Grundlage prädiktiver Analysen.
Monatliche Gremien mit IT-Leitung, Fachbereichen und Data-Experten definieren Prioritäten für KPIs (durchschnittliche Regulierungszeit, erkannte Betrugsquote, Kundenzufriedenheit) und passen Automatisierungsmaßnahmen kontinuierlich an. Diese agile Governance fördert eine gelebte Datenkultur.
Schulungen für den Umgang mit Analysetools und die Stärkung von Data Ownership unterstützen das Reifegradwachstum und verwandeln Daten in einen Innovationsmotor für den gesamten Schadenzyklus.
Vom transaktionalen Ablauf zur proaktiven Kundenbeziehung
Automatisierung der Schadenbearbeitung bedeutet mehr als Roboter oder KI-Modelle einzusetzen: Es erfordert eine Neugestaltung der Architektur, eine solide Datengovernance und eine konsequent versicherungszentrierte Prozessgestaltung. Indem Versicherer Systemfragmentierung überwinden, Betrugserkennung stärken und das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellen, erzielen sie deutliche Produktivitäts-, Zuverlässigkeits- und Zufriedenheitsgewinne.
Der Übergang vom rein transaktionalen Modell zur proaktiven Kundenbindung setzt eine modulare, skalierbare und kontinuierlich erweiterbare Plattform voraus, die neue Algorithmen und Kommunikationskanäle nahtlos integriert. Die Experten von Edana begleiten Organisationen von der Strategiedefinition bis zur operativen Umsetzung und gewährleisten dabei technologische Unabhängigkeit und nachhaltigen Kompetenzaufbau.
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit einem Edana-Experten





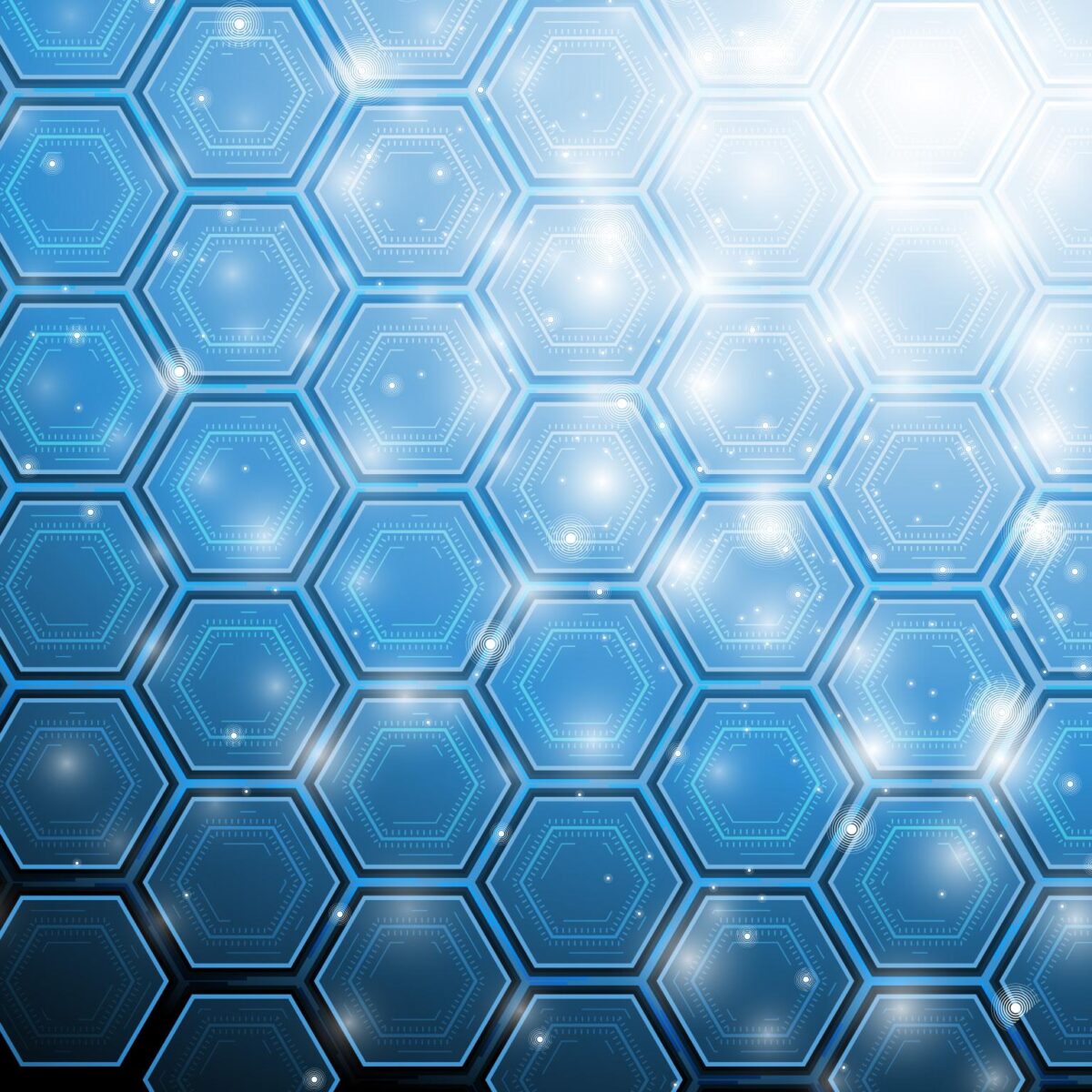

 Ansichten: 187
Ansichten: 187